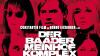Die radikalisierten Kinder der Nazi-Generation, angeführt von Andreas Baader (Moritz Bleibtreu), seiner Partnerin und Pastorentochter Gudrun Ensslin (Johanna Wokalek), der links angesiedelten Journalistin Ulrike Meinhof (Martina Gedeck), Holger Meins (Stipe Erceg) und Jan-Carl Raspe (Niels Bruno Schmidt) kämpfen gegen das, was sie als das neue Manifest des Faschismus begreifen: die US-amerikanische Politik in Vietnam, im Nahen Osten und der Dritten Welt, die von führenden Köpfen der deutschen Politik, Justiz und Industrie unterstützt wird. Die Rote Armee Fraktion erklärt der Bundesrepublik Deutschland den Krieg. Und eine junge Demokratie wird über zehn Jahre hinweg in ihren Grundfesten erschüttert.
Dass es kein Drittes Reich wie in Eichingers Kammerstück "Der Untergang" mehr braucht, um in Übersee Heil zu empfangen, hat der "Oscar"-Gewinner "Das Leben der Anderen" gezeigt. Aber eine Nominierung für diese Trophäe muss ja noch nichts heißen. Und hätte "Der Baader Meinhof Komplex" Ende Februar tatsächlich eine Chance auf den Auslands-"Oscar" haben wollen, dann wäre es Voraussetzung gewesen, dass sich die Ladies und Gentlemen der Academy aus Hollywood gründlich in die deutsche Nachkriegsgeschichte eingelesen haben: Angefangen bei den Studentenunruhen mit den Prügelpersern beim Staatsbesuch des Schahs, als der Zivilbeamte Karl-Heinz Kurras in der Krummen Straße einen Todesschuss auf den Hinterkopf des Studenten Benno Ohnesorg (Martin Glade) abfeuert und eskalierend beim Attentat auf den Wortführer der westdeutschen Studentenbewegung, Rudi Dutschke (Sebastian Blomberg).
Und weiter mit den Frankfurter Kaufhausbränden, der Baader-Befreiung, der militärischen Ausbildung in Jordanien, den ersten Banküberfällen und Bombenanschlägen auf US-Militär, hetzenden Axel-Springer-Verlag und andere bundesdeutsche Einrichtungen, der als "Isolationsfolter" gebrandmarkten Inhaftierung von Baader, Meinhof und Co. im Hochsicherheitstrakt der JVA Stuttgart-Stammheim und den blutigen Freipressungsversuchen der zweiten Generation um Brigitte Mohnhaupt (Nadja Uhl) mit der Geiselnahme von Stockholm, Landshut- und Schleyer-Entführung, der Erschießung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und Dresdner-Bank-Vorstandssprecher Jürgen Ponto, endend mit der Todesnacht von Stammheim und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten. Und dies sind nur wesentliche Stationen, die der Film seinem Konzept nach in 150 Minuten abarbeiten muss.
Nur noch illustrierte Schlagzeile
Aber eine journalistische Chronik des Terrors, wie sie Austs Werk darstellt, von 1967 bis zum "Deutschen Herbst" '77 - das ist selbst für diese Laufzeit zu viel. Stellenweise reicht es nur zu illustrierten Schlagzeilen; und die werden dann mit entsprechenden (Original-)Aufnahmen und sich überlagernder Nachrichtensprecher abgehakt - wer nicht vornweg im Bilde ist, bleibt außen vor. Fatal für einen Film, der es sich (auch) zum Ziel setzt, eine vielfach in Unkenntnis lebende Jugend fürs Thema zu sensibilisieren. Der Gefahr, dies über ein Action-Gewitter zu verkaufen, sind Eichinger und Edel indes nicht erlegen. Knalleffekt gibt's allenfalls, wenn man Gewalt als solche bezeichnen möchte: Eine hochgehende Autobombe, abgetrennte Gliedmaße oder 119 Kugeln in den Körpern von Schleyers Begleitmannschaft sind im Film das, was sie damals waren. Wie aber kam es überhaupt so weit, dass eine Truppe Weltverbesserer derart übers Ziel hinausgeschossen und in blutigem Terrorismus geendet ist?
Für Polittheorie und Psychologie, großartige Erklärungen, geschweige denn ein Nacherleben bleibt keine Zeit. Und hier macht sich das versammelte Star-Ensemble negativ bemerkbar: Abgesehen von unfreiwilliger Stadtguerilla-Sympathie ob der Schönheiten Susanne Bormann oder Alexandra Maria Lara, besteht die große Gefahr darin, dass die Handlung nicht mehr im Zentrum des Interesses steht; etwa, wenn einer wie Tom Schilling nur dazu dient, als Dutschke-Attentäter Josef Bachmann abzudrücken, um dann wieder aus dem Plot zu verschwinden.
"Hört auf sie so zu sehen, wie sie nicht waren!"
Abgesehen von den bekannten Köpfen bleibt Eichingers Produktion wie schon die Vorlage neutral. Da ein Mitgefühl den Opfern gegenüber schon deshalb unmöglich ist, weil sie auf Charaktermasken reduziert bleiben, verbuchen die Gegner (zumindest ihre maßgeblichen, der Rest an Tätern geht gleichfalls unter) des "Schweinesystems" allerdings leichte Pluspunkte in einer ansonsten durchweg gewissenhaften Aufarbeitung, die sich nicht wie andere Produktionen dem Vorwurf aussetzen lassen muss, ihren Protagonisten linkerseits mit einer gewissen Zuneigung zu begegnen: "Ihr habt sie nicht gekannt. Hört endlich auf sie so zu sehen, wie sie nicht waren!", gibt das Drehbuch nicht nur Mohnhaupts Mahnung an die zweite Generation vor, die ebenso die letzten Sprengel Pro-RAF-Stimmung in der Bevölkerung zum Kippen gebracht wie auch die Linke im Lande endgültig gespalten hat. Beides wird im Film nicht deutlich.
Das Abbild ist aber vielfach äußerst stimmig, nimmt man die millionenfach reproduzierten Aufnahmen aus der damaligen Zeit zum Maßstab, etwa der erschossene Ohnesorg (selbst das Käferkennzeichen stimmt überein), Dutschkes Rede oder die Festnahme des blondierten Baader. Auch wenn sich die Todesnacht von Stammheim keinen Spekulationen um die von vielen bis heute in Frage gestellte Selbsttötung hingibt, leistet man sich zum Schluss eine künstlerische Freiheit: Andreas Baader war jedenfalls sicher nicht das gute Gewissen der RAF. Ansonsten spielt Bleibtreu aber den rabaukenhaften Draufgänger nach, als der er überliefert ist.
Anonym Agierende - ein Ärgernis
Überhaupt trifft die Besetzung (wäre sie denn nur nicht zu prominent) ihre Vorbilder. Von Gedecks Meinhof bis hin zu Bruno Ganz als Leiter des Bundeskriminalamts und filmisches Sympathiezentrum Horst Herold. Und geradezu verblüffend ist die Ähnlichkeit zwischen einer fanatisch aufspielenden Johanna Wokalek als "heilige Selbstverwirklicherin" Gudrun Ensslin, die zeigt, dass sie auch die Kehrtwende der zerbrechlichen Leila aus Til Schweigers "Barfuss" im Repertoire hat. Das Schwäbeln hat man ihr ebenso wie dem Richtenden abgewöhnt - gut so, die Authentizität wäre in bäuerliche Lächerlichkeit gekippt.
Anonymität ist dagegen ein Ärgernis, das sich der bis dato teuerste deutsche Film durchweg leistet. Die Agierenden - zumal jene, die ungeachtet ihrer bis zum heutigen Tag bedeutenden Rollen nur Randfiguren bleiben müssen - werden dem Publikum oft überhaupt nicht vorstellig. Dabei ließe sich das ohne weiteres im Dialog bewerkstelligen. Wer sich mit der RAF-Geschichte zumindest oberflächlich beschäftigt hat, weiß natürlich, dass dies wohl Stefan Aust gewesen sein muss, der da eben Ulrike Meinhofs Kinder eingesammelt hat; Christian Klar gerade die Schüsse auf Ponto abgibt, während Peter-Jürgen Boock vor dem Haus den Fluchtwagen startet. Aber war das nun der Otto Schily neben dem hungerstreikenden Holger Meins?
Ungeklärt bleibt neben solchen Details die grundsätzliche Frage, ob und wie man diese wichtige Geschichtslektion in ihrer Gesamtheit hätte anders aufbereiten können. Das wäre wohl nur als Mehrteiler machbar gewesen - und die gehören nunmal ins Fernsehen (eine langsamer erzählte TV-Fassung soll es noch geben) und nicht auf die Leinwand. Denn dort bleibt Austs Kompendium ein Kompromiss: Gelungen bebildertes Expertenwissen, das für Laien zu komplex bleibt, um daraus nachhaltige Lehren zu ziehen.
ka-news verlost zum Verkaufsstart von "Der Baader Meinhof Komplex" dreimal die DVD. Teilnahmeschluss ist Sonntag, 12. April.
www.constantin-film.de
www.bmk.film.de