Im Karlsruhe der 1930er-Jahren findet man in der Kriegsstrasse 25 eine exklusive Möbelfirma, die für ihre hochwertigen Erzeugnisse bereits in Paris und Brüssel ausgezeichnet wurde. Hier haben die Gebrüder ihre Werkstätten und Ausstellungsräume, eine Firma für "Künstlerische Wohnungseinrichtungen", die mit Schreinerarbeiten angefangen hat und seit 1768 in Karlsruhe in Betrieb ist.
Himmelhebers Vorfahr arbeitet am Karlsruher Schloss mit
Der Schreiner Johannes Himmelheber aus Hessen kam zum Markgrafen Karl Friedrich von Baden, der ihn mit Arbeiten im großherzoglichen Schloss in Karlsruhe beauftragt hat. Später hat Himmelheber auch Schreinerarbeiten am markgräfischen Palais am Rondellplatz ausgeführt. Mit der Zeit entwickelt sich das Geschäft so zu einer der ersten Möbelfabriken des Landes.
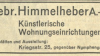
Im 20. Jahrhundert wohnt die Familie von Gustav Himmelheber in der Leopoldstraße. Hier wird 1904 der Sohn Max geboren. Was zu dem Zeitpunkt noch niemand weiß: Später wird Max Himmelheber bekannt sein als Luftwaffenpilot, ökologischer Vorreiter - und ab 1932 Erfinder der Spanplatte.
Kindheit zwischen Pfadfindergruppe und Holzspänen
Max ist das vierte von sieben Kindern. Seine Mutter Anna ist Tochter eines Finanzministers, sein Vater Gustav hat die Möbelfabrik übernommen und führt diese zusammen mit seinem Bruder. Allem Anschein nach genießt Max eine glückliche Kindheit mit geistigen und sportlichen Anregungen, wie seine Mitgliedschaft in Pfadfinder- und Wandervogelgruppen.

Als Junge beschäftigt er sich in der Schreinerei seines Vaters bereits mit den Holzspänen, die bei der Verarbeitung von Holz unbenutzt blieben. 1922 macht Max an der Goetheschule Karlsruhe sein Abitur, anschließend ein Studium im Fach Elektronik an der Technischen Hochschule Karlsruhe, welches er 1927 erfolgreich abschließt.
Wie aus Holzresten eine Holzplatte wurde
Ab 1929 führt Himmelheber seine Arbeiten in der Technik fort und arbeitet zusammen mit Professor Alfred Schmid an der Universität Basel, wo die beiden mit Holzschliff und Kunstharzen experimentieren. Das Resultat ist ein holzähnlicher Stoff - ein Vorläufer der Spanplatte. Dafür erhalten sie 1932 ein erstes Schweizer Patent.
Dieses Produkt wird schließlich zur heutigen Spanplatte weiterentwickelt. Das Besondere daran: Vor der Erfindung wurde nur rund 40 Prozent der gefällten Holzmasse genutzt, was eine enorme Verschwendung der Ressourcen darstellte. In der Schreinerei seines Vaters hat der junge Erfinder dieses Problem jedoch bereits früh erkannt - und sich zum Ziel gesetzt, eine Lösung dafür zu finden.
Himmelheber wird Kampfflieger
Doch bevor er mit seiner Erfindung seine berufliche Zukunft ernsthaft vorantreiben kann, wird es noch rund 20 Jahre dauern. Der Grund: Max Himmelheber wechselt 1934 seinen Beruf und beginnt eine Ausbildung zum Flugzeugführer und Fluglehrer im Luftfahrtministerium. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wird Himmelheber als Jagdflieger eingesetzt. Während der Luftschlacht um England 1940 hat er den Rang des Leutnants und ist Technischer Offizier des Stab I im Jagdgeschwader 2 Richthofen.

Himmelheber fliegt eine Messerschmitt vom Typ Bf 109-E4 und schießt im Krieg nur ein Flugzeug ab. Am 6. September 1940 über Staplehurst, Kent in England wird er abgeschossen und schwer verwundet. Er wird in ein Zivilkrankenhaus in Maidstone gebracht, wo er operiert und nach einer Woche in ein Militärkrankenhaus nach Woolwich überführt wird. In England bleibt Max in Kriegsgefangenschaft bis 1943 – in diesem Jahr darf er im Rahmen eines Gefangenenaustausches nach Deutschland zurückkehren.
Die Spanplatte boomt
Nach dem Krieg, im Jahr 1950 gründet Max Himmelheber die Firma Laboratorium Himmelheber in Baiersbronn im Schwarzwald. Die Firma plant und errichtet über 60 Spanplattenfabriken für industrielle Holzverarbeitung in aller Welt und vergibt rund 80 Firmen Produktionslizenzen. Alle Verfahren werden automatisiert und Himmelheber erfindet und entwickelt viele der Maschinen zur Herstellung von Spanplatten in den verschiedenen Fabriken selbst.
Mit diesen Verfahren sowie der Erfindung einer Methode, Abfallholz zu benutzen, hat Max Himmelheber einen großen ökologischen Beitrag zur Schonung der Ressourcen an Holz und Wald geleistet. Für die Möbelverarbeitung war früher nicht jeder Baum geeignet, doch zur Produktion von Holzspänen eignen sich auch qualitativ minderwertigere Bäume.

Himmelheber zieht sich ab 1970 aus der Geschäftsleitung seiner Firma zurück und widmet sich jetzt philosophischen Themen. Er gründet die Max Himmelheber-Stiftung, die wissenschaftliche und kulturelle gemeinnützige Zwecke verfolgt und "die in der Freiheit, Entfaltung und Selbstverantwortung des Menschen, sowie im Schutz des Lebens in seinen natürlichen und vom Menschen beeinflussten Ordnungen ihr oberstes Ziel sieht".
Vorreiter der Ökobewegung
Zur gleichen Zeit gründet er ebenfalls die Zeitschrift "Scheidewege", zusammen mit Friedrich Jünger. Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich und zeigt, dass Himmelheber Vorreiter der Ökobewegung war. Er plädiert für ein Umdenken in dem Umgang mit der Natur, warnt vor der Verwüstung der Erde und fordert unter anderem Recyclingverfahren.
Bis zu seinem 90. Lebensjahr schreibt Max Beiträge für diese Zeitschrift, bevor er sechs Jahr später, im Dezember 2000, stirbt. Heute erscheint die Zeitschrift jährlich und wird von der Stiftung ausgegeben. Für sein Lebenswerk und sein "beispielhaftes Wirken für das Allgemeinwohl" wurde Max Himmelheber 1987 die Theodor-Heuss-Medaille verliehen.
Aus Möbelfabrik wird Hotelkomplex
Für seine Erfindungen, seinen ökologischen Beitrag und seine Leistungen als Ingenieur, Unternehmer und Erfinder für die Ökobewegungen mit der Zeitschrift "Scheidewege" wurde er auch mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. In Baiersbronn ist die Max-Himmelheber-Straße nach ihm benannt.

In der Karlsruher Kriegsstraße 25 - dort, wo die Familie Himmelheber einst ihre Holzwerkstatt betrieb - befindet sich heute eine Baustelle. Denn: Voraussichtlich im Jahr 2023 soll hier das neue "Motel One" samt Skybar entstehen.
